Weidener Lyriker im Interview: „Im Fallen neue Höhen erreichen“
Nordoberpfalz. Der gebürtige Weidener Autor und Journalist Stefan Wirner erzählt im Interview von seinem aktuellen Gedichtband und vieles mehr.

Herr Wirner, zwischen 1999 und 2002 veröffentlichten Sie drei Cut-up-Romane, dann folgten 2011 der Lyrikband „Love to Go“ und nach zehn Jahren „Die Kunst zu fallen“. Braucht Lyrik so lange Zeit zum „Reifen“?
Stefan Wirner: Die meisten der Gedichte in dem neuen Band sind keine zehn Jahre alt, sie sind in den vergangenen drei, vier Jahren entstanden. Aber bis man sich eine geeignete Form erschlossen und eine Sammlung beisammen hat, das kann schon dauern. Ich schreibe eigentlich immer Gedichte, aber ich verwerfe viele auch wieder. Es ist ein ständiges Experimentieren. Und dann, mit einem Mal, öffnet sich eine Tür, und alles fügt sich ineinander.
Wie kam es dann dazu, dass Sie den neuen Gedichtband veröffentlicht haben?
Wirner: Wie und wann was veröffentlicht wird, das hat mit so viel Glück und Zufall und den Umständen zu tun, manchmal versteht man das selber nicht. Ich hatte eine Sammlung zusammen, die für mich einen Sinn ergeben hat. Ich hab das Manuskript ein paar Verlagen angeboten, aber mit Lyrik ist es schwer. Damit können Verleger kein Geld verdienen.
Man muss ja nur mal in die Lyrikabteilung einer Buchhandlung schauen: Was steht da? Vielleicht ein paar ausgewählte Herbstgedichte von Goethe, Liebesgedichte von Rilke und wenn es hochkommt ein Jan Wagner mit seinem unsäglichen „Giersch“. Das war’s. Doch Jürgen Brôcan, der Herausgeber der edition offenes feld, der selbst Lyriker und Übersetzer ist, und ein paar andere Idealisten lassen nicht locker. Brôcan haben die Gedichte gefallen, und so kam es.

Wenn man Ihre frühen, oftmals aktionistischen, fast schon punkigen Texte mit den neuen vergleicht, fällt einem eine angenehme Stille in den Zeilen auf. Hängt das mit dem Älterwerden zusammen?
Wirner: Wenn man vieles erlebt hat, Krisen, Trennungen, Schmerz, Todesfälle, aber auch Geburt und Glück – dann ist man nicht mehr ganz so ungestüm, man ist beeindruckt vom Leben, manchmal geschockt, manchmal überwältigt. Das lässt einen vielleicht demütiger werden. Ich habe auch früher schon stille Gedichte geschrieben, aber eine Lesung ist für mich eine Theateraufführung, eine Performance, da müssen sich die Zuhörer spüren, und ich will mich auch spüren beim Vortrag.
Ich gehe selber nicht gern zu Lesungen, wo nur eine Stunde lang ein Text vorgelesen wird. Ich kann mich da nicht konzentrieren und schweife schnell innerlich ab. Auf der Bühne muss was passieren, sonst geh’ ich mir lieber ein Bier holen. Im Übrigen kann auch ein stilles Gedicht radikal sein.
Ihre Beobachtungen sind genauer, detaillierter geworden, die Sätze knapper, aber dafür umso präziser. Ist das es ein langer Prozess, in dem an jeder Zeile, jeder Formulierung gefeilt wird?
Wirner: Manches wirft man hin aufs Blatt und es passt wie von selbst. Manches passt gar nicht, da kann man dran schleifen, wie man will, das wirft man besser weg. Und an manchen Gedichten, die einem was bedeuten, feilt man lange, und man entdeckt seltsamerweise immer wieder ein kleines Wort, das stört oder ausgewechselt werden muss. Das hört vielleicht nie auf. Wie bei einer Zeichnung, der man immer noch einen Strich hinzufügen kann.
Die Natur spielt eine wichtige Rolle in den Gedichten. Die Jahreszeiten, Blumen, Flüsse, Krähen. Eine trügerische Idylle, die sich darin verbirgt?
Wirner: Natur spielt eine Rolle, aber auch die Stadt, das Leben in den Häusern, die Straßen, der Verkehr. Ich finde die Übergangszone interessant, da wo die Stadt aufhört und das Land anfängt, wo die Zivilisation zerfasert, die Strommasten, die Windräder, die Firmen, die zerfurchten Waldstücke, die weggeworfenen Autoreifen, die Autobahnausfahrten, die Baumärkte, Deponien, die Füchse, die rumpirschen, und die Kraniche, die drüberfliegen. Wir leben im Anthropozän, wir vernichten massenweise Arten und zerstören das Klima. Am Stadtrand kann man die menschliche Destruktivität gut beobachten.
Wie schwer oder leicht ist es, heute noch Gedichte zu schreiben? Die Poesie scheint oftmals aus der Zeit gefallen zu sein.
Wirner: Wenn man sich den Krieg gegen die Ukraine anschaut, fragt man sich schon: Was soll jetzt ein Gedicht? Der Schriftsteller Maxim Biller hat ja angesichts dieser Barbarei angekündigt, mit dem Schreiben aufzuhören. Und dennoch: Für mich ist die Lyrik eine sehr passende Form für unsere Zeit. Gedanken, die in kurze Sätze, in Wörter und Bilder gefasst,
der Schnelllebigkeit entrissen werden.
Der amerikanische Lyriker William Carlos Williams hat das mal „glimpses“ genannt. Ich glaube, er meinte die winzigen Wahrnehmungen, diese Fundstücke des Denkens. Man kann sich einen Gedichtband in die Jackentasche stecken und in der U-Bahn ein Gedicht lesen, oder auf einer Parkbank, im Biergarten, dann schaut man in den Himmel und denkt über das Gedicht nach. Und vielleicht bewahrt dieses Gedicht dann in dieser Zeit etwas von unseren anderen menschlichen Möglichkeiten.
Sie haben Neuere Deutsche Literatur in Köln studiert und wandelten dort auf den Spuren Rolf Dieter Brinkmanns. Ihre Magisterarbeit in Berlin widmete sich dann dem Bayerischen in der Prosa Herbert Achternbuschs. Wie wichtig waren diese Autoren für Ihren literarischen Weg?
Wirner: Unglaublich wichtig, vor allem der Gedanke: Schreib das, was aus dir selber kommt, vergiss die Vorgaben, das, was offiziell anerkannt ist, vergiss Schulliteraten wie Günter Grass, geh den Schritt, den du selber gehen willst und der aus dir kommt. Aber neben Achternbusch und Brinkmann gibt es noch andere, die ich schätze, vor allem die französische Literatur. René Char zum Beispiel, den Dichter der Résistance, den ich immer wieder zur Hand nehmen kann.
Natürlich auch Paul Celan oder Ossip Mandelstam, der den stalinistischen Säuberungen zum Opfer fiel und in einem russischen Arbeitslager verhungert ist. Aber auch Rilke mit seiner unglaublichen Sprache. Und unter den gegenwärtigen Autoren Michel Houellebecq, dessen Gedichte nicht so bekannt sind wie seine Romane. Ihm gelingt es aber auch in der Lyrik, die Themen der Zeit anzusprechen. Es gibt in Deutschland meines Erachtens derzeit keinen vergleichbaren.
Worin besteht sie jetzt, die „Kunst zu fallen“?
Wirner: Es geht darum, wie wir mit dem Negativen in unserem Leben und in der Welt umgehen. Fallen kann ja auch etwas Befreiendes haben, man denke nur an einen Fallschirmsprung. Man kann im Fallen neue Höhen erreichen. Aber ich finde, das sollten die Leserinnen und Leser selbst herausfinden.

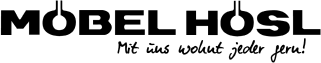
 Jobbörse
Jobbörse  Events
Events  Mediathek
Mediathek 
 Suche
Suche  Meine News
Meine News 



* Diese Felder sind erforderlich.