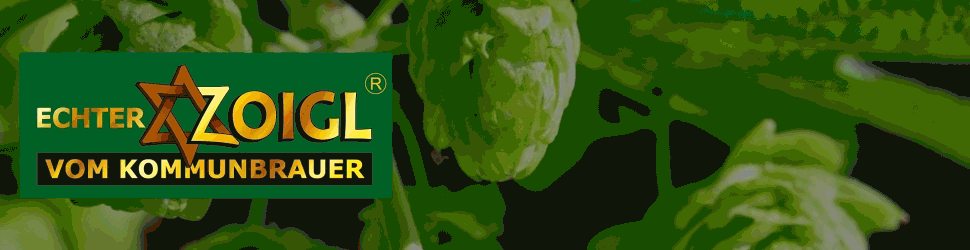Experten diskutieren Wasser- und Gletscherschutz in Weiden

Experten diskutieren Wasser- und Gletscherschutz in Weiden
Am 21. März 2024 findet auf Initiative der Vereinten Nationen erstmals der Weltgletschertag statt und auch das Motto des diesjährigen Weltwassertages am 22. März 2025 steht ganz im Zeichen von „Glacier Preservation“ (Gletscher erhalten). Beide Initiativen sollen das globale Bewusstsein für den dramatischen Schwund der Eismassen schärfen. Im Rahmen eines Expertengesprächs am Wasserwirtschaftsamt Weiden wurden die unterschiedlichen Disziplinen dieser Thematik allgemein verständlich beleuchtet und die Folgen diskutiert.
Klimawandel und seine Folgen
Nach kurzer Begrüßung durch Behördenleiter Mathias Rosenmüller moderierte Helmut Jahn (Abteilungsleiter für den Landkreis Neustadt und der Stadt Weiden) die Gesprächsrunde. Zunächst stellte Alois Fischer, stellvertretender Behördenleiter am Wasserwirtschaftsamt Weiden die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung in Bayern auf die rückläufigen Grundwasserstände der letzten zwei Jahrzehnte hin. „Die Grundwasserneubildung ist gesunken, während der Bedarf, insbesondere in trockenen Sommermonaten, weiterhin steigt“, betonte er. Zudem berichtete er von den zunehmenden Herausforderungen für Wasserlebewesen in Oberflächengewässern durch steigende Temperaturen und sinkende Pegelstände. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzt das Wasserwirtschaftsamt auf strengere Regularien bei der Genehmigung von Trinkwasserentnahmen und die Umsetzung ökologischer Maßnahmen an Gewässern. „Wir beraten intensiv die Gemeinden zu Themen wie Oberflächenabfluss und Sturzfluten im Rahmen des Hochwasserchecks“, erklärte Fischer.
Weltwassertag und Weltwasserwoche
„Wasser ist eine wertvolle und knappe Ressource, die es zu schützen gilt. Der Weltwassertag erinnert uns daran, dass wir alle Verantwortung tragen, um die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser zu gewährleisten“, erklärte Fischer und wies darauf hin, dass auch in diesem Jahr wieder die „Weltwasserwoche“ im Freilandmuseum Neusatz-Perschen stattfinden wird. Diese einzigartige Veranstaltung in Bayern animiert über 2.500 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen aus der Oberpfalz, sich praxisnah und anschaulich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen. „Die Weltwasserwoche ist ein Vorzeigeprojekt der überbehördlichen Zusammenarbeit und zeigt, wie wichtig es ist, Kinder frühzeitig für den nachhaltigen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren“, so Fischer.
Folgen der Gletscherschmelze
Dr. Frank Holzförster, Diplomgeologe, Umweltpädagoge und Wissenschaftlicher Leiter am GEO-Zentrum an der KTB, betonte im Gespräch, dass die Alpengletscher eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung Deutschlands spielen. Sie dienen als Zwischenspeicher für Niederschläge und tragen zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung bei. Dr. Holzförster wies auch auf indirekte Auswirkungen der Gletscherschmelze hin, die in Deutschland zu erwarten sind. Ein steigender Meeresspiegel könnte weitreichende Veränderungen im Fließregime der Flussläufe mit sich bringen und die idealen Fließprofile der Donau und ihrer Zuflüsse verändern. Ein Anstieg des Meeresspiegels um 100 Meter würde bedeuten, dass die Donau beim Einfließen in die Oberpfalz nur noch auf 230 m ü.NN. liegt und beim Ausfließen nur noch auf 220 m ü.NN. Diese Änderungen hätten Einfluss auf die Fließgeschwindigkeit und auf die Sedimentfracht, was sich auch auf die Nebenflüsse Naab und Regen auswirken würde.
Wissenschaftliche Forschung und Technologien
Dr. Jakob Rom, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Eichstätt-Ingolstadt gab im Rahmen seines Forschungsprojektes SEHAG (Sensitivität HochAlpiner Geosysteme gegenüber dem Klimawandel) Einblick in alpine Umweltprozesse. Um die wissenschaftlichen Daten zu Gletschern und alpinen Umweltprozessen zu erheben, kommen moderne Mess- und Monitoringsysteme zum Einsatz, zum Beispiel satellitengestützte Methoden, Drohnen- und Laserscanaufnahmen sowie GPS- und Georadarmessungen. Diese Technologien ermöglichen es, präzise Informationen über die Veränderungen der Gletscher und deren Auswirkungen auf die alpine Umgebung zu gewinnen. Dr. Rom berichtete von einer signifikanten Abnahme der Gletscherlängen und -massebilanzen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere seit 1980, als die Temperaturen durch den Klimawandel deutlich anstiegen.
Das Abschmelzen der Gletscher hat weitreichende Folgen für alpine Prozesse und Naturgefahren. Dr. Rom erklärte, dass „durch das Abschmelzen neue Landschaften entstehen, die besonders anfällig für Naturgefahren sind. So können Gletscherseen entstehen, die potenziell ausbrechen können. Zudem sorgt das fehlende Widerlager der Eismassen für instabile Hänge und Felswände, was das Risiko von Hangrutschen, Steinschlägen und Felsstürzen erhöht. Gleichzeitig entstehen neue Moränen, und Lockermaterial wird abgetragen, was zu einem erhöhten Sedimenteintrag in Talgebiete führt. Positiv zu vermerken ist, dass neuer Lebensraum entsteht, der schnell von Pioniervegetation besiedelt wird“. Dr. Rom wies zudem auf weitere alpine Umweltprozesse hin, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen: Die erhöhten Temperaturen führen zu tauendem Permafrost, was instabile Felswände zur Folge hat. Auch die Häufigkeit von Starkniederschlägen könnte zu vermehrten Murabgängen, Hochwasserereignissen und Rutschungen führen. Die montane Vegetation muss sich ebenfalls auf die veränderten Bedingungen anpassen.
Die Gesprächsrunde verdeutlichte, wie wichtig es ist, das Thema Wasser in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. „Wir alle sind gefordert, aktiv zum Schutz unserer Wasserressourcen beizutragen“, schloss Behördenleiter Mathias Rosenmüller.

 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login