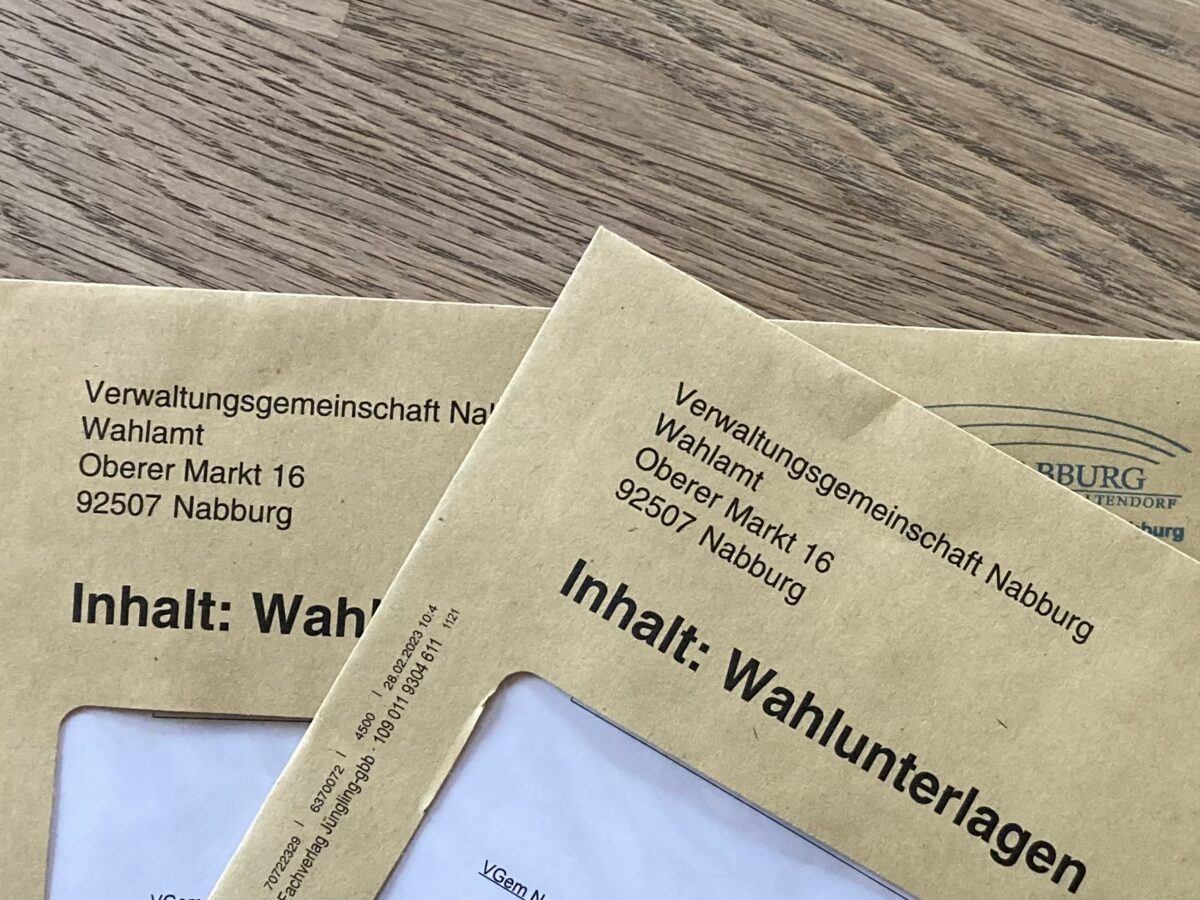Schobers-Rock-Kolumne: Frauen haben in dieser Ausgabe das Sagen
Schobers-Rock-Kolumne: Frauen haben in dieser Ausgabe das Sagen

Es gibt ja Vertriebe und (deren) Labels, da weiß man meist, was man hat und kann so wenig falsch machen. Das sind dann eher die Kleineren, WEA, Sony oder Universal sind Großkonzerne und dementsprechende Gemischtwarenläden. Thirty Tigers stehen z.B. für durchgehend grandiosen Roots-Rock und Americana-Music.
Das deutsche Pendant wäre Blues Rose. Im Indie-Bereich ist Cargo der große Mischkonzern, Beggars, Domino und PIAS (Play It Again Sam) bedienen die feineren Nischen zwischen Electronica, Shoegaze, Dream- & Art-Pop, Kammerfolk, Indie-Rock und eben auch mal dem Soul neuerer Prägung.
Bester Soul-Funk-Rock aus den geschundenen Staaten
Die Black Pumas sind so eine Kapelle, die von PIAS betreut wird und früher vielleicht mal auf Stax Records, dem Label für rockigen Soul & Funk, erschienen wäre. Bereits im vergangenen Jahr erschienen, bündelt „Live from Brooklyn Paramount“ diese überbordende Energie der Kapelle um Sänger Eric Burton und dem Gitarristen und Produzenten Adrian Quesada aus Texas.
Nachdem die Jungs erst zwei Platten veröffentlicht haben, findet man praktisch den gesamten Katalog inklusive Tracy Chapmans „Fast Car“ auf diesem Album. Und man wäre so gerne dabei gewesen!
Allerfeinstes aus dem ehemals Leopold’schen Schurkenstaat
Ebenso bereits 2024 beim gleichen Stall erschienen ist das neue Solo-Werk von Balthazars Maarten Devoldere aka Warhaus. Dem Belgier gelingt es nach dem famosen Vorgänger, „Ha Ha Heartbreak“, mit „Karaoke Moon“ erneut ein Indie-Pop-Album aus dem Schlaraffenland zu zaubern. Es hat Melodien zum Reinlegen, charmante Arrangements mit Bossa-Nova- und Yacht-Pop-Schmelz, markante, atmosphärisch richtig gesetzte Perkussion mit Congas, Handclaps oder Woodblocks, ein paar verspielte Gitarren-Licks, romantische Klavier-Passagen, Streicher und jede Art von Chören.
Dazu laszive Serge-Gainsbourg-Gedächtnis-Schmacht-Background Vocals, Spoken-Words-Performances, Dystopisches, das trotzdem charmant klingt und Geschichten über Hermann Hesse und subtile Männlichkeitsfantasien, die man vielleicht nicht allzu erst nehmen sollte. Der Mann singt, b.z.w. schmalzt wie eine Mischung aus Leonhard Cohen, Nick Cave und Matthew E. White, er ist ein Womanizer à la Bryan Ferry, aber keiner der sophistischen oder sexistisch-manierierten Sorte. Darum fährt der Mann auch Fahrrad und wird nicht im Smoking abgebildet.
Diese Ladys haben Schmackes!
Apropos abbilden: guckt man sich das Artwork des neuen Albums von Megan und Rebecca Lovell, besser bekannt als Larkin Poe an, weiß man auch, wo der Barthel seinen Most holt. Da sitzen die Schwestern, stilvoll gekleidet neben einem Gitarrenverstärker, drumherum ein Meer aus roten Rosen. „Bloom“ (Indigo) heißt somit das Album, der Nachfolger von „Blood Harmony“ vom letzten Jahr für den es einen Grammy für das beste zeitgenössische Blues-Album gab.
Die jetzige Blüte ist ebenfalls tief im Blues verwurzelt, spielt aber erneut mit allen Facetten des Americana, sei es nun County, Folk oder Southern-Rock. Thematisch geht es darum, sich selbst in dieser lärmenden Welt zu finden, sich zu akzeptieren und das Beste bei einem aufrechten Gang daraus zu machen. Im romantisch schwelgenden Rausschmeißer, „Bloom Again“ versuchen die Schwestern eine Annäherung an Phil und Don Everly und feiern sich zu Pedal Steel im anheimeligen Duett-Gesang. Sonst geht’s nämlich deutlich rauer zur Sache.
Verspieltes Indie-Karussell aus New York
Und noch mehr Frauen-Power aus den USA (ohne auf den Slogan vom Vollpfosten „America First!“ anzuspielen)! Nora Cheng, Penelope Lowenstein und Gigi Reece kommen aus New York und haben bereits 2022 mit Ihrem Debüt Schlagzeilen gemacht. Nicht nur, dass es mit Mitgliedern von Sonic Youth und Produzent John Agnello (Dinosaur Jr., Kurt Vile) eingespielt wurde, es erhielt auch Höchstbewertungen im Rolling Stone.
Für den Nachfolger, „Phonetics On and On“ (Matador) haben sich die Horsegirls Cat Le Bon als Produzentin geschnappt und gehen etwas andere Wege. Die Dame zerrte Violinen, Synths und ein Gamelan mit ins Studio und gab den Songs mehr Freiheiten zu atmen und Neues auszuprobieren. Am Ende bleibt es aber doch ein liebevoll schrammelndes, lakonisches, augenzwinkerndes Indie-Rock-Album mit viel DIY-Charme. Dass die Mädels zusammen mit den Breeders auf Tournee gingen, passt wie die berühmte Faust aufs Auge.
Alle Daumen gedrĂĽckt fĂĽr diese Ausnahmepflanze aus eigenem Anbau
Auch dem weiblichen Geschlecht zugehörig ist die Berliner Kosmopolitin, Multiinstrumentalistin und Produzentin Albertine Sarges. Und auch Ihr Debüt wurde mit viel Anerkennung bedacht, der Deutschlandfunk Kultur nominierten sie z.B. als Newcomer des Jahres 2021. „Girl Missing“ (Moshi Moshi Records) knüpft an das Debüt an und verzaubert mit vielseitigem Indie-Rock, Art-Pop, aber auch Blues- und Jazz-Schnipsel der durch die Kate Bush meets Jane Waever-artige Stimme Sarges seine besondere, bitterzarte Note erhält. Die Künstlerin gibt sich bewusst eklektisch, zitiert aus ein paar Jahrzehnten Pop- und Rock-Geschichte, beginnend mit dem Country-Folk eines Neil Young bis hin zu Talking Heads-artigen Passagen.
Flöten, Synthis, Orgeln, Cello und Violine, auch der instrumentelle Fundus ist breit gestreut, sodass dieses Album immer wieder mit neuen Wendungen und Verästelungen um die Ecke kommt. Es handelt von emotionaler Abgründigkeit am Rand der Klippe, über im Hausflur hingelegte Blumen, hat skurrile und alberne Momente (der letzte Satz ihres Albums lautet: „How do you call a fish with no eyes? A fsh“), nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch nur scheinbar widersprüchliche Gefühle. Diese entfalten sich als bemerkenswert lebendig und lebensnah und erzählen die Geschichte eines Verlusts und der Möglichkeit von Erneuerung. Das seit langer Zeit spannendste Album aus deutschen Landen!
Als stĂĽnden die besinnlichen Tage erst vor der TĂĽr
Kurz vor Schluss noch ins Non-binäre abzutauchen, sparen wir uns jetzt mal und widmen uns den in Streichern badenden Melodien einer Sophie Jamieson. Und aufgemerkt, auch hier handelt es sich erst um ihren zweiten Longplayer. Die britische Singer-Songwriterin besingt auf „I Still Want To Share“ (Bella Union) zutiefst persönliche Reflexionen über die zyklische Natur des Liebens und Verlierens, die Angst, die wir nicht aus unseren Beziehungen heraushalten können, und die ständige Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die uns dazu antreibt, immer wieder zu versuchen, bei anderen Menschen ein Zuhause zu finden, und dabei zu scheitern.
Themen, die wie gemacht für ein ruhiges, melancholisches Album gemacht zu sein scheinen und es auch sind. Leicht verhangen die Stimme zwischen Sharon Van Etten, Lisa Germano and PJ Harvey verdrängt die akustische Gitarre das wohltemperierte Klavier des Erstlings, bleibt es nicht minimalistisch, mischen sich schon besagte Streicher, ein Omnichord oder Harmonium ein. Besinnliches, auch nach der Weihnachtszeit.

 Jobbörse
Jobbörse
 Events
Events
 Mediathek
Mediathek

 Suche
Suche
 Login
Login